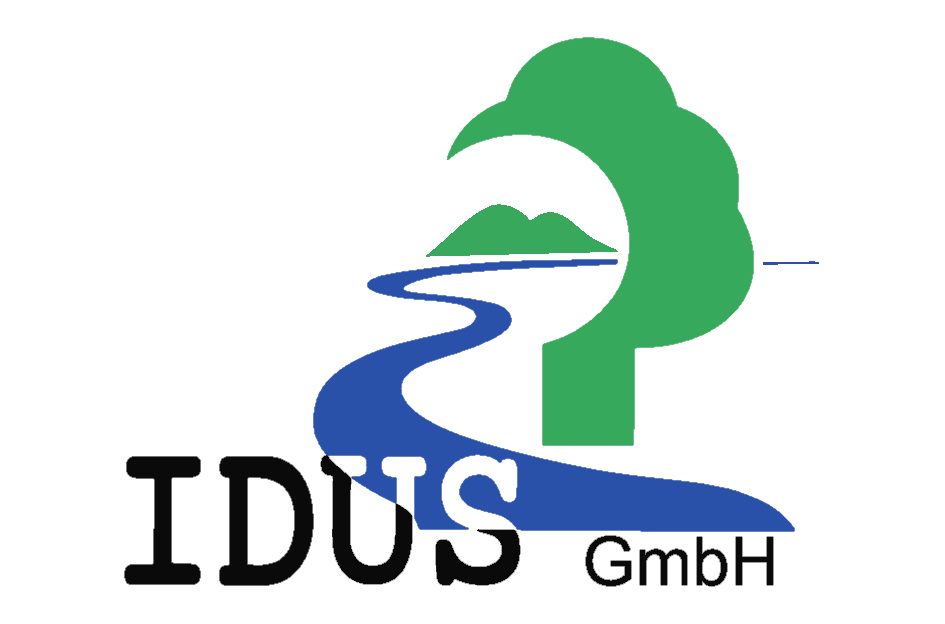Ökotoxikologische Analysen / Biologische Abbaubarkeit
Die Testverfahren zur Wasser- und Abwasseranalytik sowie zur Produktprüfung basieren auf DIN-Vorschriften (Deutschland) und OECD-Normen (Europa).
Fischeitest
Der Fischeitest nach DIN EN ISO 15088 (T6):2009-06 eignet sich zur Untersuchung der akuten Wirkung wasserlöslicher Chemikalien, Suspensionen oder Dispersionen sowie für potentiell im Abwasser, Oberflächen- oder Grundwasser befindliche Schadstoffe.
Für eine erweiterte Exposition sind wir ebenfalls für den Fischembryonentest (FET) nach OECD 236 (Stand 26.07.2013) akkreditiert. Die Expositionszeit erstreckt sich dabei bis zum Schlupf der Jungfische und gibt Hinweise auf die Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffen im Wasser über das Embryonalstadium hinaus.
Daphnientest
Der akute Daphnientest nach DIN 38412-L30:1989-03 wird zur Bestimmung des GD-Werts verwendet und findet vor allem Anwendung bei Abwasser, Oberflächen- oder Grundwasser.
Die akuten Toxizitäts-Tests nach DIN EN ISO 6341-L40:2013-01 bzw. OECD 202 (Stand 13.04.2004) dienen eher der ökotoxikologischen Untersuchung von wasserlöslichen chemischen Substanzen oder Suspensionen. Mithilfe geometrischer Reihen sowie statistischer Auswertungen können EC- bzw. NOEC/LOEC-Werte ermittelt werden.
Im semistatischen Reproduktionstest nach OECD 211 (Stand 02.10.2012) wird die chronische Wirkung von Testsubstanzen über 21 Tage getestet. Auch hier können Effektkonzentrationen über verschiedene Konzentrationsstufen analysiert werden.
Algentest
Der Algenhemmtest nach DIN 38412-L33:1991-03 wird zur Bestimmung des GA-Werts verwendet und findet vor allem Anwendung bei Abwasser, Oberflächen- oder Grundwasser.
Die Toxizitäts-Tests nach DIN EN ISO 8692-L9:2012-06 bzw. OECD 201 (Stand 28.07.2011) dienen eher der ökotoxikologischen Untersuchung von wasserlöslichen chemischen Substanzen oder Suspensionen. Mithilfe geometrischer Reihen sowie statistischer Auswertungen können EC- bzw. NOEC/LOEC-Werte ermittelt werden.
Leuchtbakterientest
Der Leuchtbakterientest nach DIN EN ISO 11348-2 (L 52):2023-12 eignet sich zur Untersuchung der akuten Wirkung wasserlöslicher Chemikalien, Suspensionen oder Dispersionen sowie für potentiell im Abwasser, Oberflächen- oder Grundwasser befindliche Schadstoffe. Eine Ermittlung von EC- bzw. NOEC/LOEC-Werten ist ebenfalls möglich.
weitere ökotoxikologische Testverfahren
Neben den ausführlich beschriebenen standardmäßig angebotenen Verfahren können von der IDUS Biologisch Analytisches Umweltlabor GmbH sowie in Zusammenarbeit mit Partnerlabors weitere Test zur Prüfung spezieller ökotoxikologischer Fragestellungen bzw. verschiedener Umweltmedien nach Anfrage fachgerecht durchgeführt werden.
Folgende Verfahren können bei Bedarf angeboten werden:
- Pseudomonas-Zellvermehrungs-Hemmtest nach DIN EN ISO 10712-L8:2019-05
- umu-Test zur Bestimmung des erbgutverändernden Potentials nach DIN 38415-T3:1996-12 (Nachauftragnehmer)
- Atmungshemmtest mit Belebtschlamm (DIN EN ISO 8192-L39:2007-05 bzw. OECD 209)
Abbautests
Abbautests
Diese Tests werden für Abwässer und Produkte durchgeführt, um den Anteil leicht abbaubarer Substanzen zu identifizieren und Informationen über den Abbau in Abwasserbehandlungsanlagen oder in der Umwelt zu liefern.
Abbautests dienen der Bewertung der Mineralisierbarkeit von Substanzen in der Umwelt und der Überprüfung des Verhaltens von Abwässern bei der biologischen Abwasserbehandlung. Es gibt genormte Verfahren, darunter solche nach DIN, DIN/EN/ISO und OECD, die verschiedene Versuchsparameter und Nachweisverfahren verwenden. Das Labor der IDUS GmbH führt Routinetests zur Kohlenstoffabbaubestimmung (DOC/TOC-Analytik) und Sauerstoffverbrauch (elektrochemisch, manometrisch) durch. Bei speziellen Anforderungen bieten sie auch Beratung und maßgeschneiderte Testlösungen an.
Zahn-Wellens-Test
Der Zahn-Wellens-Test (DIN EN ISO 9888, OECD 302B) ist ein häufig verwendeter Test zur Bestimmung der aeroben biologischen Abbaubarkeit von Substanzen. Er verfolgt den Abbau anhand der Abnahme des DOC und ist in der Produkt- und Abwasseruntersuchung weit verbreitet. Der Test liefert Informationen zum Adsorptionsverhalten und zur Flüchtigkeit von Substanzen und verwendet eine hohe Anfangsbiomasse von abbauenden Organismen, oft aus Kläranlagen. Der Test kann für gelöste, nicht flüchtige Prüfsubstanzen durchgeführt werden.
Leichte biologische Abbaubarkeit
Testverfahren für die Prüfung der biologischen Abbaubarkeit.
Manometrischer Respirationstest (OECD 301F)
Dieser Test erfolgt in speziellen Flaschen mit Druckmessköpfen und einem Gasraum über der Wasserphase. Ein Kohlendioxid-adsorbierendes Mittel wird hinzugefügt, und der Sauerstoffverbrauch führt zu einem Druckabfall, der den biologischen Abbau repräsentiert. Geeignet für flüchtige und unlösliche Substanzen.
Closed Bottle Test (DIN EN ISO 10707 oder OECD 301D)
In geschlossenen Testgefäßen wird die biologische Abbaubarkeit über 28 Tage hinweg durch die Messung des gelösten Sauerstoffs ermittelt. Dieser Test kann auch für flüchtige Chemikalien verwendet werden und ist kostengünstig. Adsorptionsprozesse spielen keine Rolle.
DOC-Abbau
Verfahren zur Ermittlung der Abbaubarkeit durch die Eliminierung von DOC erfolgen gemäß OECD 301A, OECD 301D oder DIN EN ISO 7827 (L29). Der Test ähnelt dem Zahn-Wellens-Test, verwendet jedoch weniger Inokulum (aktive Biomasse).